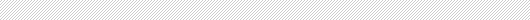"Wir kamen in eine L?cke hinein"
Ibbenb?rener Volkszeitung vom 16. September 2006
Cornelia Ruholl. Ibbenbüren. Das Quasi So-Theater feiert am 27./28. September 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass sprach Cornelia Ruholl mit Ulla Dorenkamp und Robert Rickert über das Theater der VHS, über Anfänge, Entwicklungen und Veränderungen.
Wie hat alles angefangen?
Dorenkamp: Ich leitete in den siebziger Jahren eine Theatergruppen in Mettingen und wir wurden eingeladen, anlässlich der Eröffnung des Bürgerhauses, 1976, dort aufzutreten. Da haben wir "Balle, Male, Hupe, und Arthur" gespielt, das war so ein richtig rotziges Stück vom Berliner Kindertheater. Und da haben wir gemerkt, dass die Leute nicht einfach nur hineinschauten, sondern die saßen tatsächlich die ganze Vorstellung da. Heribert Fischer, der damalige Leiter der VHS, rief uns dann an und fragte, ob man nicht einen VHS-Kurs daraus machen könnte. Eigentlich ist Heribert Fischer der Gründer des Quasi So Theaters. Gaby Althoff hat uns mitbetreut, und dann hat sich alles schnell entwickelt. Eines unserer ersten Stücke war "Momo". Die Leute drängten sich vor dem Bürgerhaus. Da habe ich noch immer ein Bild vor Augen: Ein Akkordeonspieler, so ein richtiger Schrank von Mann, musste sich regelrecht in der Tür breit machen, damit die Leute nicht mehr nachdrängten, so voll war es. Es gab ja nicht so viel Theater oder überhaupt Kulturangebote in Ibbenbüren. Da gab es gerade mal den Theaterring. Da kamen wir in eine schöne Lücke `rein und die haben wir genutzt. Danach hatten wir bei den Theateraufführungen immer volle Häuser. Das war natürlich ein Ansporn.
Wie haben sich die Aufgabe und auch das Publikum im Lauf der Zeit verändert?
Rickert: Ich würde sagen, die Theaterlandschaft hat sich verändert. Es hat sich weg verlagert von den problembeladenen Stücken hin zu Stücken, die Amüsement und Spaß versprechen. Mit schweren Stücken haben wir es heute schwer. Dazu passt auch der große Erfolg von "Ladys Night". Das sieht man auch in der Jugendabteilung. Mit Problemstücken kann man die Leute schlecht begeistern. Auch für die Akteure auf der Bühne ist die Lust am Spiel, daran, sich zu zeigen, sich zu bewegen, wichtig.
Wie sind Sie selbst zum Theater gekommen?
Dorenkamp: Ich konnte mir nie etwas anderes vorstellen. Wenn in der Schule eine Lektüre so trocken durchgenommen wurde, zum Beispiel Maria Stuart oder der Sommernachtstraum, stellte ich mir gleich eine Aufführung vor. Aber niemand wollte die Sache in die Hand nehmen. Alle wollten nur spielen. Deshalb habe ich gesagt: Passt auf, Ihr kriegt die Rollen und ich mache das. Selbst auf der Bühne gestanden habe ich deshalb nur im Extrachor auf der Bühne in Münster.
Rickert: Bei mir war das ganz anders. Ich wollte nie Theater spielen. Aber eines Tages konnte eine Rolle nicht besetzt werden, und Ingeborg Grau hat meine Frau angesprochen und die hat mich dann überredet: "Du, die brauchen auch noch jemanden mit Bart". Am Ende habe ich dann den Sultan gespielt. Und es waren wohl diese ersten Stunden auf der Bühne, die es mir angetan haben. Das war etwas, wozu ich vorher gar keine Beziehung hatte.
Wieviel Zeit müssen Sie aufwenden für die Theaterarbeit?
Dorenkamp: Das hängt von der Größe der Projekte ab. Im Erwachsenenbereich arbeitten wir ja projektbezogen.
Rickert: Im Kinder- und Jugendbereich beim "Rabatz-Theater", eine Einrichtung der evangelischen Markus-Paulusgemeinde, wird kontinuierlich das ganze Jahr über zwei mal wöchentlich vier bis fünf Stunden geprobt. Da machen 35 Kinder und 18 Jugendliche mit.
Dorenkamp: Zehn davon sind bei Anatevka dabei, ein Riesenprojekt mit 50 Musikern im Orchester, der rund zehnköpfigen Tanzabteilung, rund 30 Darstellern und etwa 60 Chorsängern. Die Arbeit kann man nicht in Stunden zählen.
Was ist das Rezept für Ihre erfolgreiche Regiearbeit?
Rickert: Wir beschäftigen uns nicht in erste Linie mit dem Produkt, sondern sind uns bewusst, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, mit ihren Fähigkeiten und ihren Einschränkungen. Wir haben einen eher theaterpädagogischen Ansatz, gehen nicht mit zu klaren Regievorstellungen in ein Stück.
Dorenkamp: Unsere Schauspieler bringen sehr viel Begeisterung, Spielfreude und Talent mit. Aber es gibt Grenzen. Und wenn wir merken: Das geht so nicht, dann gehen wir gegebenenfalls an den Text und verändern ihn, soweit verantwortbar, so, dass es für uns spielbar wird. Unsere Stücke werden sozusagen entwickelt. Dazu bringen wir viel Geduld und Flexibilität mit. Aber unsere Spieler sagen auch, dass das für sie anstrengend ist.
Wie schafft man es, ein Theater wie das Quasi So zu finanzieren?
Dorenkamp: Wir haben nun mit der Schauburg eine eigene Spielstätte. Das ist toll, wie es den jungen Leuten gelungen ist, mit ihrer Euphorie das Projekt durchzusetzen. Aber das bringt auch die Sorge: Wie geht es weiter. Wir müssen sehen, dass wir für die nächste Spielzeit wieder ein ansprechendes Programm dort bieten. Eigentlich ist es zu wenig, wenn ein Stück sich nur trägt, die Stücke müssen Geld einspielen.
Rickert: Anfänge schultert man vergleichsweise leicht. Jetzt muss die Euphorie erhalten werden. In Bezug auf die Schauburg muss man vor allem an die großzügigen Sponsoren denken, die uns den Rücken frei halten. Das sind erhebliche Summen.
Dorenkamp: Wir machen für jedes Stück eine Kalkulation, die dann vorn Vorstand geprüft wird. Dabei hilft die Erfahrung. Man kann sagen, in letzter Zeit lagen wir beide immer ganz gut. Wichtig sind auch immer das große Kindertheater zu Weihnachten und der Adventskalender, das spielt Geld ein, womit man auch andere Dinge subventionieren kann. Deshalb geben wir uns da auch immer sehr viel Mühe.
Wie haben sich die Zuschauerzahlen entwickelt?
Dorenkamp: Gegenüber den Anfangsjahren sind sie sehr zurück gegangen. Man muss aber sehen, dass Ibbenbüren gegenüber früher ein sehr vielfältiges kulturelles Angebot hat. Die Zahlen sind zudem stark stückabhängig. Bei einem Tennessee Williams ist es gut, wenn 60 Leute da sind.
Haben Sie einen Wunsch für Quasi So?
Dorenkamp: Wir brauchen mehr Nachwuchs in den technischen Bereichen. Da könnten doch junge Leute kommen, die in die Aufgaben hineinwachsen können. Das Üble ist, dass alle immer auf die Bühne wollen.